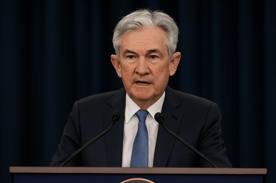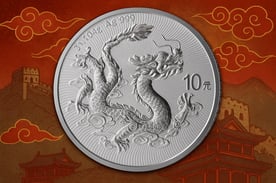Trumps Zollpoker: Japan zahlt den Preis für Amerikas Wirtschaftsnationalismus
Während Europa noch immer mit den drakonischen 20-Prozent-Zöllen der Trump-Administration kämpft, hat sich Japan geschickt aus der Affäre gezogen – oder doch nicht? Das jüngste Handelsabkommen zwischen Washington und Tokio offenbart die knallharte Realität der neuen amerikanischen Handelspolitik: Wer mit den USA Geschäfte machen will, muss zahlen.
Der Deal: 15 Prozent und eine halbe Billion Dollar
Donald Trump verkauft das Abkommen als "das größte, das jemals geschlossen wurde" – eine für den ehemaligen Reality-TV-Star typische Übertreibung. Doch die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Japan verpflichtet sich zu Investitionen von sage und schreibe 550 Milliarden Dollar in den USA. Das entspricht etwa 470 Milliarden Euro – mehr als das gesamte deutsche Bundesbudget eines Jahres.
Die Zollsenkung von 25 auf 15 Prozent mag auf den ersten Blick wie ein Erfolg für Japan aussehen. Doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich der Deal als teuer erkaufter Kompromiss. Während die EU weiterhin 20 Prozent zahlt und Mexiko sowie Kanada sogar mit 25 Prozent zur Kasse gebeten werden, darf sich Japan über den "niedrigsten Zollsatz unter den Ländern mit Handelsüberschuss" freuen – ein schwacher Trost angesichts der massiven Investitionsverpflichtungen.
Die Gewinner: Japans Autobauer jubeln – vorerst
An der Tokioter Börse brach Euphorie aus. Der Nikkei-Index schoss um 3,5 Prozent nach oben, Toyota-Aktien explodierten förmlich mit einem Plus von über 14 Prozent. Die japanischen Autobauer, die seit Jahrzehnten den amerikanischen Markt dominieren, können aufatmen. Keine Importquoten, "nur" 15 Prozent Zölle – das klingt nach einem Sieg.
"Wir haben Verhandlungen geführt, um zu schützen, was geschützt werden muss", erklärte Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba.
Doch was genau wurde hier geschützt? Die Profitmargen japanischer Konzerne auf Kosten amerikanischer Arbeiter? Die Kritik der US-Autobauer General Motors, Ford und Stellantis ist berechtigt: Während japanische Importe mit 15 Prozent davonkommen, müssen amerikanische Hersteller für Teile aus Mexiko und Kanada weiterhin 25 Prozent zahlen. Ein Wettbewerbsnachteil, der Arbeitsplätze in Detroit gefährdet.
Die wahren Kosten: Japans Souveränität auf dem Verhandlungstisch
Was Trump als "Anweisung" an Japan bezeichnet, offenbart die neue Machtdynamik im Pazifik. Japan wird nicht nur zur Kasse gebeten, sondern auch politisch in die Pflicht genommen. Die versprochene Marktöffnung für amerikanische Agrarprodukte, insbesondere Reis, trifft einen empfindlichen Nerv der japanischen Gesellschaft. Der Reisanbau ist nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern kulturelle Identität.
Die Beibehaltung der 50-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium zeigt zudem, dass Trump nur dort nachgibt, wo es ihm nützt. Die strategisch wichtigen Grundstoffe bleiben weiterhin mit Strafzöllen belegt – ein klares Signal an alle Handelspartner: Amerika first, ohne Kompromisse.
Ein Blick in die Zukunft: Europas teure Lektion
Während Japan sich mit einer halben Billion Dollar freikauft, verharrt Europa in einer Schockstarre. Die 20-Prozent-Zölle treffen die exportorientierte deutsche Wirtschaft besonders hart. Die Frage ist nicht ob, sondern wann Berlin und Brüssel ähnliche "Deals" eingehen müssen. Die Alternative? Ein Handelskrieg, den Europa nicht gewinnen kann.
Die Philippinen haben bereits kapituliert: 19 Prozent Zölle für philippinische Exporte, null Prozent für amerikanische Importe. Ein Ungleichgewicht, das die neue Weltordnung des Handels definiert.
Gold als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten
In Zeiten, in denen Handelsabkommen zu Erpressungsinstrumenten werden und Währungen durch politische Willkür an Wert verlieren, gewinnen physische Edelmetalle an Bedeutung. Gold und Silber kennen keine Zölle im privaten Besitz, unterliegen keinen politischen Launen und bewahren seit Jahrtausenden ihren Wert. Während Aktien von Handelskriegen gebeutelt werden und Anleihen unter der Inflation leiden, bieten Edelmetalle Stabilität und Sicherheit. Eine Beimischung von 10 bis 20 Prozent physischer Edelmetalle sollte in keinem ausgewogenen Portfolio fehlen – besonders in Zeiten, in denen die Weltwirtschaft zum Spielball einzelner Politiker wird.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik